Faulenbach, Karl August: Lernfeld Sozialwissenschaften. Ansätze zur Fächerintegration im sozialwissenschaftlichen Lernbereich der Sekundarstufe I (1980)
6. Strukturmerkmale eines integrierten sozialwissenschaftlichen Curriculums
6.1 Ergebnisse
Die traditionellen Integrationsansätze sind bisher bis auf wenige Ausnahmen an der "Macht des Faktischen" gescheitert. Die zunehmende Verwissenschaftlichung des Unterrichts und in ihrem Gefolge auch seine weitere Zersplitterung haben die gesamtunterrichtlichen Reformkonzepte nicht aufhalten können, u.a. weil sie an überholten ganzheitlichen Positionen (Heimatkunde z.B.) festgemacht waren. In der verwissenschaftlichten und "verwalteten" Schule haben sie ihre Reformansprüche nicht durchsetzen können.
"Es ist allgemein bekannt, warum die Bemühungen um 'Sozialkunde', 'Gemeinschaftskunde', 'Politikunterricht' oder welcher Begriffe man sich auch immer bedient, zu Recht kritisierbar sind: Vorherrschen des Harmoniecharakters, keine für den Schüler erkennbare Integration der einzelnen Teilgebiete oder der mißlungenen Versuche, Kenntnisse in Handlungen umzusetzen." (2) Diese Kritik ist an den meisten hier vorgestellten didaktischen Modellen geleistet worden. Aus der Aufarbeitung der wichtigsten Modelle hinsichtlich ihrer politisch-didaktischen Intentionen (Oberste Lernziele; Erkenntnisinteresse und gesellschaftspolitische Prämissen) und ihrer Integrationsaspekte (ob praktiziert oder nur gefordert) gilt es an diesem Punkt Konsequenzen zu ziehen, die für oder gegen die Integration sprechen. Wenn man einmal von der Fülle der möglichen Zwischen- oder alternativen Lösungen (z.B. Kooperation oder Politischen Bildung als Unterrichtsprinzip aller Fächer) absieht, die letztlich doch auf diese oder jene Lösung angelegt sind, ist, falls das Ergebnis positiv ausfällt, etwa im Sinne von Wulf zu fordern: "Die Didaktik politischer Bildung bedarf einer Ergänzung und Ausweitung durch ein Konzept für politisch-sozialwissenschaftliche Curriculumentwicklung... ."(3)
An dieser Stelle ist nur noch einmal zusammenzufassen, welche Fächer, welche fachdidaktischen oder fächerübergreifenden Modelle die Integration wie begründen. Die zentrale Rolle der Fachdidaktiken für die Frage der Fächerintegration ist im folgenden formuliert: "Die Begründung für die Gestaltung eines Schulfaches ist weder eine einzelwissenschaftliche noch eine wissenschaftstheoretische Aufgabe, sondern Aufgabe der Fachdidaktiken (sofern sie vorhanden sind.)"
Die didaktische Position für oder gegen Integration ist auch immanent eine wissenschaftstheoretische. "Die anthropologische Bedeutung des Faches muß von der Idee des teilnehmenden und teilhabenden Bürgers her interpretiert werden (Selbst- und Mitbestimmung als Normen des GG)." (4) Das Erkenntnisinteresse eines jeden Faches, das auf Emanzipation gerichtet ist, geht In seiner Wissenschaftstheorie ebenfalls von einer gesellschaftlich vermittelten Funktion der Wissenschaften aus.
Das drückt sich ebenfalls in einer positiven Einschätzung der Fächerintegration aus, wie Schwerdtfeger es formuliert: "Die Integration von Schulfächern ist der Versuch, auf die zunehmende Differenzierung In den Wissenschaften didaktisch produktiv zu reagieren, denn:
- Niemand kann bestreiten, daß sich aus der Vermehrung von Wissen und aus der gleichzeitigen 'Verwissenschaftlichung des Lebens' eine Reihe guter Gründe ableiten lassen, daß die neuen Fächer (bzw. das neue Wissen) im Kanon der Schulfächer repräsentiert sein sollten. [/S. 162:]
- Ebensowenig Ist bestreitbar, daß die Vielzahl der Fächer von keinem Lehrer (geschweige denn von den Schülern) beherrschbar oder auch nur in ihrer Gesamtheit als 'Ganzes' vorstellbar sind.
- Eine 'direkte' und additive Repräsentation von Wissenschaften und Wissensanteilen in der Schule ist aus evidenten Gründen sinnlos (Köpfe von Kindern sind kein Müllplatz)." (5)
Die Mehrzahl der didaktischen Modelle der verschiedenen sozialwissenschaftlichen Fächer sind u.a. als ein Versuch zu werten, auf die Herausforderung der wissenschaftlichen Spezialisierung zu reagieren, indem das Verbindende zwischen den Disziplinen betont wird. Alle diese Fächer wollen Politische Bildung betreiben und den "mündigen Staatsbürger" erziehen, gleichzeitig aber auch die jeweiligen Fachansprüche nicht aufgeben. (6)
Aus einer noch ganzheitlichen Weltschau, z.T. mit metaphysischen Dimensionen, fordern die "konservativen" Didaktiker der sozialwissenschaftlichen Fächer einen Gesamtunterricht, der entsprechende Werte vermitteln soll. Dem Gefühl der "Sinnentleertheit" durch die wissenschaftlich-pluralistischen Auffassungen wollen sie begegnen durch die Verknüpfung der Fächer, um damit verlorene Ideale wieder zurückholen zu können.
Von den "positivistischen" Didaktiken gibt es kaum Argumente für eine Fächerintegration, denn ihr "wertfreier" Ansatz verzichtet bewußt auf politische Prämissen und eine gesellschaftliche Rechtfertigung ihrer wissenschaftlichen Zielsetzung. Die weitere Auffächerung der Wissenschaften ist für diese Haltung fast eine logische Konsequenz. Ihre Zielsetzung gibt sich zweckfrei und ist abgeleitet aus der Systematik der Wissenschaft und dem Grundrecht des Grundgesetzes auf "Freiheit der Wissenschaften". Daraus resultiert ein "pluraler" Ansatz von Wissenschaften, der nur da, wo es methodologisch notwendig ist, auf eine andere Wissenschaft zurückgreift aber in der Integration keinen Sinn sieht, da die Wissenschaften in eine andere Richtung tendieren. Einen Sinn von Wissenschaften über diese hinaus sehen sie nicht. "Es gibt keine generelle Bestimmung von einigem Wert (für die Sozialwissenschaften; der Autor). Man kann zwar eine Definition geben, die verschwommen genug ist, alle Disziplinen zu umfassen; sie ist aber dann so vage, daß sie unbrauchbar ist." (7) Logischerweise kann es für die aus dieser wissenschaftlichen Position abgeleiteten Didaktiken keine Fächerintegration geben. Wenn es zu dem wie bei ihnen "nur" um den "mündigen Staatsbürger" oder "Wahlbürger" geht, ist das mit reinem Fachwissen über die Rechte und Pflichten, über die Institutionen und das Erlernen der Kulturtechniken und die Vermittlung der fachwissenschaftlichen Kenntnisse getan. Die vorhandenen Bemühungen auch einiger dieser Didaktiken für Integration bleiben letztlich voluntaristisch und für die politische Sozialisation inkonsequent, denn sie leisten nicht, was sie vorgeben, sie bleiben affirmativ. (8)
Eine Wissenschaftstheorie, deren Erkenntnisinteresse in der Emanzipation des Menschen liegt, und die alle menschlichen Handlungen in einen historischen Prozeß eingebettet sieht, schreibt auch den Wissenschaften, den Didaktiken, dem Unterricht und der Politischen Bildung eine ganz bestimmte logische Funktion für die Gesellschaft und den Geschichtsprozeß zu, ohne sie jedoch total zu reglementieren. Sie bekommen ihren Sinn und ihre Berechtigung von dem gesellschaftlichen Ziel her. Das trifft in verstärktem Maße für den sozialwissenschaftlichen Unterricht zu: "Das Handeln des Bürgers (sofern es nicht den Grenzfall des 'Berufspolitikers' betrifft) ist 'Politisch' (und nicht 'spezialisiert'); es basiert auf der [/S. 163:] Annahme einer allen Bürgern als Gleiche konstituierenden Vernunftfähigkeit und der daraus abgeleiteten Idee einer gemeinsamen Ordnung, in der die prinzipielle Gleichheit aller Bürger realisierbar ist und mit ihr die Realisierung von Freiheit und Glück ('Reich der Freiheit' als Ziel der Geschichte)." Der politische Bürger ist das Ziel, nicht der Bürger als Spezialist. Daraus resultiert die Notwendigkeit einer fächerintegrierenden Politischen Bildung, da es gilt, den politisch handelnden Bürger mit der oben genannten Intention zu "sozialisieren". (9) Besonders "... unter dem Gesichtspunkt einer parteilichen politischen Didaktik, welche zur kollektiven Emanzipation der Lohnabhängigen den ihr möglichen Beitrag leisten will, sind auf dem Gebiet der Methodologie der didaktische Materialismus ... der adäquate Bezugsrahmen" und damit auch die Fächerintegration, wie sie aus den entsprechenden didaktischen Entwürfen entwickelt worden ist. (10)
Die didaktisch relevanten (progressiven) Positionen der einzelnen Fächer lassen ihre Bezogenheit aufeinander erkennen und vermitteln die logische Konsequenz, aus der oben genannten Zielsetzung, eine integrative sozialwissenschaftliche Didaktik zu entwerfen. (11)
Die Auseinandersetzung der Menschen mit ihrer Umwelt innerhalb eines weitgehend organisierten und institutionalisierten Rahmen (Staat), ist letztlich zweckgerichtet auf die Realisierung des "Reiches der Freiheit". (12) Die zentralen Kategorien der hier behandelten sozialwissenschaftlichen Fächer sind Raum, Zeit, Herrschaft/Institution, Interaktion/Sozialisation und Arbeit/Wirtschaft. Sie sind konstitutiv für die menschliche Gesellschaft. Aber erst die Erkenntnis ihrer Interdependenz ergeben einen zielgerichteten Sinn für die Gesellschaft - sieht man von einer metaphysischen Sinngebung ab. Die räumliche Bezogenheit der Menschen ist logischerweise auch eine historische und umgekehrt. Die Gesellschaft und ihre Umwelt Ist bestimmt durch die Auseinandersetzung der Menschen (in Interaktionen und organisiert durch Institutionen) mit der Natur durch Arbeit und deren Organisation (Wirtschaft). Beides wird getragen von der politischen Herrschaft. (13)
Nun läßt sich argumentieren, die Fülle der einzelnen Disziplinen, die diese Probleme aufarbeiten, sei inzwischen so groß, daß ihre Verknüpfung mehr verwirre als orientiere. Das ist im Grunde jedoch unlogisch. Denn bei der Betonung etwa nur räumlicher Faktoren werden die anderen so vernachlässigt, daß letztlich die ganzen Informationen dann beliebig werden, nicht mehr stimmig sind, sich sogar widersprechen können, und es wohl kaum der Intelligenz der Schüler überlassen bleiben kann, innerhalb von fünf Jahren Schule (S I) irgendwann einmal die Ergebnisse und Erkenntnisse der Fachdisziplinen wie bei einem Puzzle aus eigenem Vermögen zusammenzufügen. Wenn bei allen Disziplinen eine politische Erziehung der Selbst- und Mitbestimmung oberster Wert ist, dann ergibt sich daraus die Schlußfolgerung, bei dem jeweiligen Unterrichtsthema genau das Interdependente der gesellschaftlichen Probleme auch interdependent zu vermitteln, um mehr als die Anhäufung von nur vergeßlichem Faktenwissen zu leisten. (14)
In den beiden folgenden Schemata soll der Versuch gemacht werden, aus den "progressiven" Fachdidaktiken die Integrationselemente der Fächer auf den Begriff gebracht aufzuschlüsseln. Das sozialwissenschaftliche Umfeld, in einem schematisierten Schaubild skizziert, läßt die Zusammenhänge der Grundkategorien der einzelnen Fächer erkennen, wenn Gesellschaft von einem Ziel (Emanzipation) her interpretiert wird. (15) Die Ziele, Inhalte, Methoden lassen den zusammenhängenden Charakter und die gegenseitige Ergänzung der sozialwissenschaftlichen Fächer erkennen. (16) [/S. 164:]
[/S. 164:]
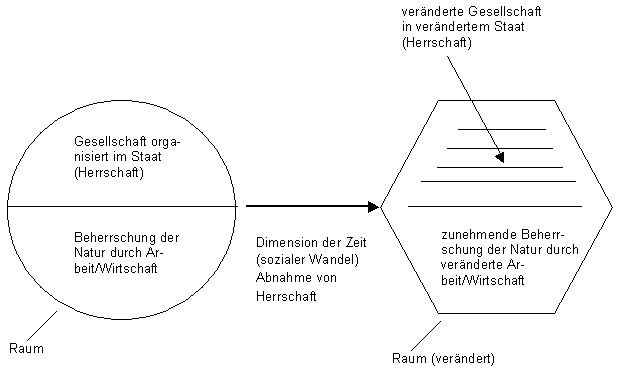
[/S. 165:]
| Fächer | Ziele | Inhalte | Methoden/ Fertigkeiten | Fächerverbindungen |
| Arbeit/Wirtschaft (Arbeit) |
Erkenntnis des Grundwiderspruchs von Kapital u. Arbeit Warencharakter und Entfremdung der Arbeit Alternative: Selbst- u. Mitbestimmung im Produktions- u. Konsumtionsbereich |
Entwicklung u. Stand der Produktivkräfte Berufs- u. Verbraucherorientierung Polytechnik: Werken - Handwerk - Industrie - Wirtschaftsmodelle |
handwerkliche Grundtechniken Ökonomische Modelle Betrieb u. Markt (Planspiele) |
politische politökonomische historische polytechnische (technische) |
| Geographie (Raum) |
Erfassung u. Erfahrung raumbedingter Strukturen Daseinsfunktionen Selbst- u. Mitbestimmung bei der Gestaltung des Raumes "Erde" |
Naturräumliche und sozialräumliche Bedingungen und Strukturen der Erde Daseinsfunktionen |
Erschließung des Raumes durch Karten, Bilder, Medien, Statistiken Orientierung im Raum |
politische ökonomische soziale sozial- u. wirtschaftshistorische (naturwissenschaftliche) |
| Geschichte (Zeit) |
Prozeßcharakter der gesellschaftlichen Entwicklung, Veränderbarkeit der Gesellschaft durch Selbst- u. Mitbestimmung | Stufen der historischen Entwicklung Veränderbarkeit von Arbeit u. Herrschaft (sozialer Wandel) "Ziel" u. Theorien der Geschichte |
Erschließung von Quellen, Quellenkritik/Chronologie Stufen/Epochenmerkmale |
politische ökonomische soziale und soziologische geographische |
| Politische Bildung (Herrschaft) |
Selbst- u. Mitbestimmung bezogen auf das Demokratiegebot, Fähigkeit zum aktivem pol. Handeln | inner- u. intergesellschaftl. Konflikte, Institutionen-"Kunde" Funktion des Rechts verschieden. Herrschaftsformen | Handlungs- und Aktionswissen, Analyse von Gesetzen und anderen politischen Quellen | politökonomische historische geographische soziale u. soziologische |
| Sozialisation / Soziologie Gesellschaft / Interaktion |
Erkenntnis des primären Erfahrungsfeldes Struktur und Wandel der Gesellschaft, gesellsch. Totalität, Identitätsbildung | primäre Sozialerfahrungen, Erfahrungsdefizite gesellschaftl. Strukturen und Konflikte | Methoden der empirischen Sozialforschung Theorien der Gesellschaft |
politische historische politökonomische (geographische) (psychologische) |
[/S. 166:] Die behandelten Richtlinien haben Integrationsansätze unterschiedlicher Signifikanz. Die weitestgehende Integration des sozialwissenschaftlichen Lernbereichs ist im Rahmenlehrplan G/P der Gesamtschule in NW zu finden, bzw. in den hessischen Rahmenrichtlinien. Der Integrationsanspruch dieser Richtlinien leitet sich aus dem obersten Lernziel der Selbst- und Mitbestimmung im Sinne des Demokratiegebots des Grundgesetzes ab. Daraus folgt der Anspruch, den Schülern die gesamtgesellschaftliche Realität vermitteln zu wollen, die in den Lernfeldern für die Schüler sinnvoll strukturiert wird. Die beteiligten Fachwissenschaften, die auch bisher im Unterricht nicht berücksichtigte Disziplinen umfassen, haben sich in Ihren Beiträgen dem Ziel der Richtlinien unterzuordnen und zur Vermittlung der Erkenntniszusammenhänge mit ihren fachspezifischen Erkenntnissen und Methoden beizutragen. Die gegen die Richtlinien vorgebrachten grundlegenden Einwände sind widerlegt worden, so daß ihr Integrationsanspruch als wissenschaftlich und didaktisch haltbar angesehen werden kann. Die Integrationansätze der beiden hier behandelten Lehrpläne sind nicht so ausgeprägt, u.a. weil sie in ihren Zielforderungen nicht so weit gehen und nicht auf der gleichen gesellschaftlichen Analyse beruhen wie die Rahmenrichtlinien und der Rahmenlehrplan. (17)
So weit wie die empirisch nicht abgesicherten Erfahrungen Schlußfolgerungen zulassen, war und ist die Praxis des integrierten Lernbereichs Gesellschaft/Politik in den Gesamtschulen praktikabel, in den Augen der Lehrer und der Gesamtschulbeobachter erfolgreich, effizient im Sinne einer stärkeren Politisierung der Schüler und dem traditionellen Unterricht überlegen. Belege dafür finden sich in den positiven Stellungnahmen der Gesamtschullehrer für diesen Lernbereich und den Rahmenlehrplan, und sie dokumentieren sich in der Fülle der von den Gesamtschulen entwickelten integrierten Unterrichtseinheiten.
6.2. Didaktische Konsequenzen und Strukturmerkmale eines integrierten sozialwissenschaftlichen Curriculums
Die Konsequenzen aus der Überprüfung des bisher gesagten können nur lauten:
Fächerintegration im sozialwissenschaftlichen Lernbereich.
Zur Überwindung bzw. zur Verhinderung der Atomisierung des Unterrichts und damit der Bewußtseinsprozesse bei Schülern ist der "ideologische" Bereich des Unterrichts (die sozialwissenschaftlichen Fächer) so zu organisieren, daß das Lernziel der Selbst- und Mitbestimmung realisierbar ist. Die Schüler sollen die gesellschaftlichen Grundstrukturen erkennen, ihre eigene Identität finden und durch eine affektive Betroffenheit zu politisch aktiven, solidarisch handelnden Bürgern im Sinne dieses Lernziels motiviert werden. Das kann aber nicht intentional geschehen durch einen atomisierten, an Fachsystematiken festgemachten Unterricht.
Eine Alternative bietet der integrierte sozialwissenschaftliche Unterricht, wie er mit den Rahmenrichtlinien bzw. dem Rahmenlehrplan konzipiert worden ist. Die Anlehnung an den Rahmenlehrplan ist eine grundsätzliche Entscheidung für das oberste Lernziel, für einen integrierten Unterricht und die ihm korrespondierende Projektmethode. Aus der Aufarbeitung der didaktischen Modelle, der Lehrpläne und der unterrichtlichen Praxis haben sich allerdings einige Korrekturen und Erweiterungen ergeben, die es zu berücksichtigen gilt.
[/S. 167:] Die kritischen Einwände gegen die beiden Lehrpläne richteten sich zum einen auf formale Mängel, die ohne große Schwierigkeiten zu beheben sind. Kritisiert wurde besonders die unüberschaubare Länge des Lehrplans, seine Unübersichtlichkeit, die Disharmonie zwischen den Arbeitsschwerpunkten und den Arbeitsbereichen und die soziologisch überfrachtete Sprache.
Durch die Herausnahme der fachspezifischen Arbeitsschwerpunkte - sie hatten überwiegend taktischen Charakter, um die fachspezifischen Einwände aufzufangen (18), durch den Verzicht auf die Teile über Unterrichtsorganisation und die Materialhinweise, die unsystematisch und unvollständig den Lehrplan mehr belastet haben als das sie für den Lehrer eine Hilfe waren, sind diese Mängel zu beheben. Die beiden letzten Punkte könnten in gesonderten, für die Lehrer viel ergiebigeren Materialteilen aufgezogen werden, wie es z.B. in NW durch eine Materialkartei in Anlehnung an die Themenstichworte geschehen ist. Die Unterrichtsorganisation könnte an Unterrichtsbeispielen ebenfalls gesondert exemplifiziert werden.(19)
Der Vorwurf der mangelnden Übersichtlichkeit ist in NW durch die "Übersicht über die Jahrgänge" behoben worden. (20) Der mangelnde Bezug zu fachwissenschaftlichen Methoden, Fähigkeiten und Fertigkeiten Ist in NW ebenfalls durch das Programm der Intensivkurse angegangen und abgebaut worden. (21) Im Lehrplan würde der konkrete Verweis auf die Intensivkurse in Form von Stichworten wie "Luftbild", "Gebrauch der Kartenlegende" usw. genügen. Die soziologisch überfremdete Sprache müßte da, wo es ohne Schaden für den Sinn des Lehrplans geht, bereinigt werden. Das trifft ebenfalls zu auf den Mangel an geographischen Lernzielen und Themenstichworten. (22) Die formalen Mängel sind also z.T. schon behoben worden und dürften bei einer nochmaligen Überarbeitung zu lösen sein.
In einem weiteren Punkt ist der fehlende Begründungszusammenhang für die Lernfelder bzw. die Arbeitsbereiche anzugehen, weil sonst die Frage im Raum bleibt, warum diese Lernfelder und keine anderen. Ebenso ist ihre Zahl "vier" kritisch zu überprüfen, besonders unter dem Aspekt, daß die tragenden Fächer des sozialwissenschaftlichen Lernbereichs, die Geographie und die Geschichte, als Lernfelder nicht mehr direkt im Lehrplan zum Zuge kommen. Sie sind zwar,- wie belegt worden -, immanent In allen vier Lernfeldern, in den Lernzielzusammenhängen, in den Lernzielen und den Themenstichworten vertreten, sie laufen aber trotzdem Gefahr, in ihrem fachspezifischen Wert im Lehrplan und damit in der Praxis zu kurz zu kommen. Das Problem ist deshalb vorrangig zu lösen. Im Gesamtschulversuch in NW ist aus diesem Grunde, um den historischen Aspekt stärker zu berücksichtigen, eine historisch-chronologische Unterrichtsreihe entwickelt worden mit dem Titel "Arbeit und Herrschaft", um für jede historische Epoche/Stufe in komprimierter Form ihre charakteristischen Merkmale aufzugreifen und zu vermitteln. (23)
Gewissermaßen exemplarisch sollten, beginnend mit der Urgesellschaft über die Antike, den Feudalismus, den Frühkapitalismus, den Kapitalismus, den Imperialismus bis hin zur Gegenwart und Zukunft, die gesamtgesellschaftlichen Strukturmerkmale von Arbeit und Herrschaft politökonomisch aufgearbeitet werden. Das wäre sicher eine Ergänzung im Interesse des Faches Geschichte unter gleichzeitiger Berücksichtigung des obersten Lernziels. Analog dazu wäre für die Geographie zu verfahren. Indem die Grunddaseinsfunktionen aufgegriffen werden, um sie an einzelnen Beispielen als die Grundkategorien der Geographie zu demonstrieren.
[/S. 168:] Die beiden Fächer sollten als neue Lernfelder V und VI die bisherigen vier Lernfelder ergänzen, aber natürlich genauso wenig abschottet und isoliert verstanden werden wie die anderen Lernfelder. Wie in der Reihe "Arbeit und Herrschaft" und von der Zielsetzung des Lehrplans angelegt, müßten Unterrichtseinheiten die für das jeweilige Verständnis notwendigen Disziplinen in die Planung mit einbeziehen. (24) Damit würde der gesamte Lernbereich Gesellschaft aus insgesamt sechs interdependenten aber strukturierenden Lernfeldern bestehen, die ihre Berechtigung aus dem Lernbereich Sozialwissenschaften, aus dem obersten Lernziel, den Fachdidaktiken und den Fachwissenschaften ableiten. Aus dieser umfassenden Begründung ist der Lernbereich nur noch z.T. identisch mit den fachdidaktischen Modellen.
Das Lernfeld I Sozialisation erhält seine Begründung aus der Aufarbeitung der unmittelbaren Erfahrung der Schüler. Aktive Teilnahme an Lernprozessen lassen sich am ehesten aus der eigenen Erfahrung angehen, wie sie im Sozialisationsprozeß besonders der Familie, der Schule, dem Stadtteil und dem Spiel (+ Erfahrungsdefiziten der Kinder) möglich sind. Die drei Formen der Erfahrungsdimension wie sie B. Schaeffer darstellt, wären zu berücksichtigen:
- Kompensation subjektiver Erfahrungsdefizite;
- Rekonstruktion objektiver Erfahrungszusammenhänge über
- Gegenstände
- Individuen,
- Organisationsformen;
- Produktion kollektiver Erfahrungsperspektiven. (25)
Das Lernfeld II Arbeit / Wirtschaft ergibt sich aus dem ursprünglichen - durch die Trennung von Familie und Produktion verloren gegangenen - primären Erfahrungsfeld der Kinder, die früher mit der Arbeit der Eltern direkt in Berührung kamen und mit ihr aufwuchsen - und dem späteren Erfahrungsfeld der Schüler als zukünftige Lohnabhängige. Die praktische Begabung vieler Schüler, die zentrale Stellung der Arbeit im menschlichen Leben, die defizitäre Einschätzung gerade der produktiven Arbeit in der gegenwärtigen Gesellschaft lassen es sinnvoll (26) erscheinen, den Bereich der Arbeit und Wirtschaft aus der direkten Erfahrung, also polytechnisch aufzugreifen, um ihre Dimension, ihre Struktur und ihrer Veränderbarkeit richtig einschätzen zu können. Zu vermitteln ist die zentrale Kategorie von Kapital und Arbeit und die damit zusammenhängenden Konflikte, ihre Ursachen und Lösungsalternativen.
Das Lernfeld III Öffentliche Aufgaben ergibt sich aus dem politischen Handlungsraum, dem Staat, den Institutionen, in denen sich auch das Leben der Schüler schon vollzieht. Zentrale Kategorie ist der Konflikt, der von den Schülern ebenfalls (in Ansätzen auch durch eigene Aktionen) in der Schule und darüber hinaus erfahren und aufgearbeitet werden kann.
Das Lernfeld IV Internationale Konflikte und Friedenssicherung bezieht seine Begründung aus der weltweiten Verflochtenheit der Gesellschaften und Staaten und der Verantwortlichkeit für die Menschen über die Grenzen des eigenen Landes hinaus. Eine menschenwürdige Gesellschaft ist letztlich eine alle Menschen umfassende Weltgesellschaft.
Das Lernfeld V Zeit erfährt seine Begründung aus dem historischen Charakter aller gesellschaftlichen Erscheinungsformen. Sie ist zwar immanent in den anderen Lernfeldern enthalten, sollte aber mit bewußt herausgehobenen historischen Be[/S. 169:]zügen erweitert werden, um aus der Aufarbeitung der historischen Erfahrung die Veränderbarkeit der Gesellschaft und Natur durch die Arbeit und die eigene historische Identität intensiver zu erkennen und um handlungsfähige Kompetenz zu erlangen.
Das Lernfeld VI Raum ist aus der Dimension abgeleitet, in der sich das gesellschaftliche Leben bewegt: dem Raum. Es geht um die Vermittlung der Grunddaseinsfunktionen, die raumrelevant sind; sich fortpflanzen, arbeiten, wohnen, sich versorgen und konsumieren, sich erholen und sich bilden. Verkehrsteilnahme.
Weitere Lernfelder könnten möglich sein, sind aber wegen der Gefahr der Zersplitterung nicht sinnvoll. Die Beiträge weiterer Fachdisziplinen bei bestimmten Themenstichworten sind auch ohne eigene Lernfelder zu berücksichtigen. Grundlegendes Prinzip bei den Lernfeldern ist ihre Hilfsfunktion zur Erfassung gesellschaftlich relevanter Themen, die jedoch in fast allen Fällen in mehrere Lernfelder hineinreichen, aber schwerpunktmäßig von einem ausgehen sollen. Das Schema "Übersicht über die Jahrgänge" (s. Seite 170) veranschaulicht die erweiterten Lernfelder. (27)
Der Zielsetzung eines solchen Curriculummodells und seinem Integrationsansatz korrespondiert In weiten Teilen die Projektmethode, deren Merkmale kurz skizziert werden sollen:
- "die Beteiligung von Lehrern und Schülern an der Planung und Durchführung des Unterrichts,
- die gemeinsame Findung des Themas und der Lernziele,
- die Überwindung der Fächergrenzen und
- die Handlungsrelevanz des Themas." (28)
Die zentralen Merkmale dieser Methode ziehen eine Fülle von Schwierigkeiten für ihre unterrichtliche Anwendung nach sich. So bereitet ein an Lernzielen festgemachter Unterricht enorme Probleme, die Schüler "echt" an der Planung zu beteiligen, denn die Ziele sind ja Vorgaben, die nicht so ohne weiteres geändert werden können. In letzter Konsequenz müßte die Mitbestimmung allerdings bis hin zu den Lernzielen gehen. Weitere Schwierigkeiten sind von der Schulaufsicht und den Eltern zu befürchten, wenn der Unterricht nicht mehr in den gewohnten und durch Richtlinien gesicherten Bahnen verläuft. Es mag sein, daß der Nebenfachcharakter die Proteste zurückhält, solange nicht auch noch politisch "Anrüchiges" in den Projekten erarbeitet wird. (29)
Der andere Punkt in der Praxis, der problematisch zu sein scheint, ist die Handlungsrelevanz des Themas. Sie birgt für einen Lehrer zusätzliche Belastungen und Risiken, mit dem Unterricht über den Klassenraum hinauszugehen. Nur werden es ihm die Schüler danken, denen damit der Sinn von Schule wieder erschlossen werden könnte, besonders in den oberen Jahrgängen. (30) Die Vorteile der Projektmethode für den integrierten Unterricht sind ohne weiteres einsichtig: Zum einen wird das Lernziel der Selbst- und Mitbestimmung im Lernprozeß, also der schulischen Sozialisation, ernst genommen und zum ändern ist die Fächerintegration von der Methode ebenfalls eingeschlossen, wenn es das Thema erfordert. Sie bereitet die Chance, den Ernstcharakter des Lernziels und des Lernprozesses zurückzugewinnen und damit die Chance, die Vermittlung von Erkenntniszusammenhängen in den Mittelpunkt zu rücken. [/S. 170:]
| Lernfelder Jg. |
I Sozialisation |
II Arbeit/Wirtschaft |
III öffentliche Aufgaben |
IV Internationale Konflikte |
V Zeit |
VI Raum |
| 5/6 | wie bisher im RLP und Erfahrungsdefizite |
wie bisher im RLP mehr polytechnische Bildung |
wie bisher im RLP | wie bisher im RLP | Urgesellschaft Antike |
Sich fortpflanzen und in Gemeinschaft leben Wohnen |
| 7/8 | wie bisher im RLP und Erfahrungsdefizite |
wie bisher im RLP mehr polytechnische Bildung |
wie bisher im RLP | wie bisher im RLP | Feudalismus Frühkapitalismus Kapitalismus |
Arbeiten sich versorgen und konsumieren |
| 9/10 | wie bisher im RLP und Erfahrungsdefizite |
wie bisher im RLP mehr polytechnische Bildung |
wie bisher im RLP | wie bisher im RLP | Imperialismus Gegenwart Alternative Modelle |
sich bilden sich erholen Verkehrsteilnahme |
[/S. 171:] Die groben Strukturen des Lehrplans würden zusammengefaßt wie folgt aussehen (31):
- Bestimmung und Begründung des obersten Lernziels
- Ableitung und Begründung der sechs Lernfelder
- Übersicht über die Lernfelder
- Darstellung der jeweiligen sechs Lernfelder und ihrer
- Lernzielzusammenhänge
- Teillernziele
- Themenstichworte
- Fähigkeiten und Fertigkeiten auch fachspezifisch in Form von Verweisen auf
- Intensivkurse
6.3 Hinweise zur Implementation
Bei der Realisierung eines solchen curricularen Vorhabens sind wenigstens drei Punkte zu beachten, wenn das ganze Projekt nicht scheitern soll:
- Die formale und inhaltliche Organisation des Unterrichts
- Die Lehreraus- und -fortbildung
- Die politische Absicherung
Der gesamte Lernbereich könnte - wenn man von der bisherigen Stundenzuweisung für die Einzelfächer ausgeht - 7 bis 10 Wochenstunden mit auf der Stundentafel für sich beanspruchen. Das wäre auf jeden Fall für jeden Unterrichtstag eine Doppelstunde. Das Schuljahr wäre für den Lernbereich in achtel Zeiten einzuteilen, wovon zwei Achtel zur freien Verfügung stehen würden und die restlichen sechs Achtel für die sechs Lernfelder, so daß im Schnitt für jedes Lernfeld eine Unterrichtszeit von ca. 50 Stunden zu erwarten wäre. (32) Das würde für jeden Lernbereich 3-4 Unterrichtseinheiten bedeuten. Es sollten aber für die beiden traditionellen Lernbereiche Raum und Zeit im Höchstfall eine Unterrichtseinheit mit ca. 20 Stunden laufen, so daß besonders für den polytechnischen Unterricht noch mehr Zeit zur Verfügung stehen würde. (33)
Innovationen bleiben Makulatur solange die Lehrer nicht in das Vorhaben einbezogen werden, also die Lehreraus- und -fortbildung entsprechend ausgerichtet werden. Nur in Form von Erlassen wird eine Schulreform von der bestehenden Praxis unterlaufen.
Für das hier vorgetragene Konzept wäre eine frühe Beteiligung der Betroffenen notwendig, bevor Lehrer und Wissenschaftler in die Detailarbeit der Curriculumentwicklung gehen würden. Schon hier müßte besonders die betroffene Öffentlichkeit beteiligt werden, ähnlich wie es in der Zukunft bei größeren städtebaulichen Maßnahmen gesetzlich vorgeschrieben Ist: die Öffentlichkeit schon im Planungsstadium zu beteiligen. (34) Das Lernziel der Selbst- und Mitbestimmung würde damit nicht vor der Schultür enden, sondern einen alle gesellschaftlichen Bereiche umfassenden Lernprozeß initiieren.
Anmerkungen
[/S. 204:] 6. Strukturen eines integrierten sozialwissenschaftlichen Curriculums (S.161 - 171)
(1) Die Kurzfassung der Thesen sollen hier mit den zusammengefaßten Ergebnissen der einzelnen Kapitel .verglichen werden. Ausführlicher ist dabei die These zu den didaktischen Modellen geraten, weil sie die grundlegenden Strukturen eines integrierten sozialwissenschaftlichen Curriculums darstellen.
(2) Dieckmann/Bolscho: Gesellschaftswissenschaftlicher Unterricht, Bad Heilbronn 1975, S. 10.
(3) Wulf, C.: Das Politisch-sozialwissenschaftliche ..., a.a.O., S. 19.
(4) Schwerdtfeger, E.: Integration unter historischem Aspekt, Thesenpapier zu einem Referat mit Diskussion auf der Tagung "Theorie und Praxis des integrativen Unterrichts" ..., a.a.O., S. 3 f.
(5) Ebd., Punkt 14.
(6) In dieser Diskrepanz stehen fast alle positivistischen Modelle, die zwar das Dilemma auch spüren, ober nicht in der Lage sind, abgehoben von ihrer Disziplin, Lösungen zu suchen.
(7) Vgl. dazu noch diese Position der "Positivisten" oder auch "kritischen Rationalisten" bei Scriven, M.: Die Struktur ..., a.a.O., S. 295.
(8) Politische Bildung auf den Ebenen dieser didaktischer Modelle bleibt auch dann affirmativ, wenn integrative Bemühungen vorhanden sind, die nicht zur "Totalität" der Gesellschaft vorstoßen können und wollen.
(9) Schwerdtfeger, E.: Integration ..., a.a.O., Punkt 16.6.
(10) Vgl. besonders die "linken" Entwürfe, die aufgrund ihrer gesellschaftlichen Analyse zu der logischen Konsequenz vorstoßen über Fächerintegration die Atomisierung des Lernprozesses zu beenden. Vgl. Christian, W.: Probleme ..., a.a.O., S. 43.
(11) Auch unter Berufung auf das Grundgesetz, daß ja eindeutig für Demokratie votiert, d.h. für Selbst- und Mitbestimmung, ist eine entsprechende Didaktik zu entwerfen. [/S. 205:]
(12) Siehe hierzu etwa Marx, Bloch, Dahrendorf u.a..
(13) Zusammengefaßt ergibt diese die knappe "Formel", die allerdings noch nicht zielgerichtet ist. Aber erst die Zielsetzung der Selbst- und Mitbestimmung gibt der "Formel" einen Sinn.
(14) Das soll kein Plädoyer gegen Faktenwissen sein, nur kann Faktenwissen alleine keine gesellschaftlichen und individuellen Aufgaben und Probleme lösen helfen.
(15) Mit der Formulierung "Abnahme von Herrschaft" und "zunehmenden Beherrschung der Natur" kann die doppelte Intention eines sozialwissenschaftlichen Curriculums umschrieben werden; erstens: die Erkenntnis der gesellschaftlichen Zusammenhänge zu vermitteln und zweitens: die Schüler in die Richtung zu motivieren, sich gesellschaftlich zu aktivieren.
(16) Das folgende Schema ist im SS 1974 in seinen Grundzügen mit Studenten in einem Seminar über Fächerintegration an der PH-Ruhr erarbeitet worden.
(17) Vgl. dazu noch die Richtlinien und Lehrpläne für die Grundschule In NW, 1973. Im Kapitel über die "Aufgaben und Organisation der Grundschule" heißt es: "Durch die Verbindung der Inhalte verschiedener Lernbereiche wird es möglich Projekte zu entwickeln, in denen der Unterricht um eine konzentrierte Mitte organisiert ist." Die hier angekündigten fächerübergreifenden Projekte finden sich allerdings nicht in dem erwarteten Maße in den Lehrplänen. Insgesamt sind die Richtlinien allerdings der Wissenschaftsorientierung stärker ausgeliefert und damit der Spezifizierung der Fächer und nicht ihrer Integration.
U. Theißen: "Meines Erachtens wird durch die inhaltliche und strukturelle Aufteilung des Sachunterrichts nach den traditionellen Fächern in den Lehrplänen der hoffnungsvolle Ansatz, den Sachunterricht nach fachübergreifenden Inhalten in Form von Projekten zu strukturieren, zerstört." Ders.: Die Neuorientierung der Geographiedidaktik und ihre Auswirkung auf den Sachunterricht der Grundschule, in: schwarz auf weiß, 3/1974, S. 6.
Der Lehrplan Sozialkunde/Politik für Hamburg 1973 geht von der Aufgabe aus, komplexe Zusammenhänge durch fächerübergreifende Projekte zu verdeutlichen, allerdings ohne die Fächer selbst aufzulösen. Vgl. dazu Mommsen, H.; Gesellschaftliche Emanzipation ..., a.a.O. S. 9.
(18) Besonders den Widerstand der Gymnasiallehrer in Hessen.
(19) Vgl. dazu die Anmerk, im Kapitel 4.3.
(20) Vgl. die Übersicht auf S. 128.
(21) Siehe dazu ebenfalls die Ausführungen zu Kapitel 4.3.
(22) Sie sind sicher von der Gesamtzahl unterrepräsentiert; nur ist das kein grundlegendes Problem, das sich nicht lösen ließe.
(23) Vgl. dazu die Ausführungen im Kapitel 5.
(24) Z. B. Geographie, Ökonomie und Sozialwissenschaften.
(25) Siehe dazu B. Schaeffer: Erfahrungen als Grundlagen ..., a.a.O., S. 113. In dieser tabellarischen Übersicht versucht sie die "Didaktische Dimension des erfahrungsorientierten sozialen und politischen Lernens und der Gesellschaftslehre" zusammenzufassen.
(26) Das soziale Ansehen (Stufenleiter des sozialen Aufstiegs) und das Arbeitseinkommen steigen mit der Entfernung von einem manuellen Arbeitsplatz.
(27) Die Lernziele können ebenfalls wie die meisten Themenstichworte aus dem Lehrplan übernommen werden.
(28) Definition des Projektbegriffs bei Mütler/Faulenbach u.a.: Stellungnahme ..., S. 85; zu konkreten Projekten siehe Müller, H.: Projektunterricht z.B. Chile, z.B. Obdachlosigkeit. Zur Praxis des gesellschaftspolitischen Unterrichts, in: päd:extra, 1/76, S, 27 ff.; Projektorientierter Unterricht. Lernen gegen die Schule? hrsg. von der Redaktion b:e, Weinheim 1976.
(29) Aus meiner eigenen Erfahrung und der begleitenden Beobachtung der Gesamtschulen glaube ich, daß ein engagierter politischer Unterricht möglich ist, der bis hin zu Aktionen der Schüler gehen kann.
(30) Die Schulmüdigkeit und die Aggressivität der Schüler hat etwas zu tun mit der Abgehobenheit des Lernens von der Praxis, dem Leben und der "Sinnlosigkeit", die hinter der Schule steckt, wenn vielen Schülern die Aussicht auf einen Arbeitsplatz verstellt ist.
[/S. 206:]
(31) In Anlehnung an den Rahmenlehrplan bzw. die Rahmenrichtlinien Gesellschaftslehre.
(32) Bei einer normalen Unterrichtszelt von ca. 32 Stunden pro Woche.
(33) Die polytechnischen Projekte sollten so angelegt sein, daß über einen längeren Zeitraum gearbeitet werden könnte. Voraussetzung dazu Ist die Bereitschaft von Firmen, diesen Unterricht durchzuführen und/oder die Ausstattung der Schulen mit Werkstätten.
(34) Vgl. dazu das neue Bundesgesetz in der Neufassung vom 18. August 1976, Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1976, Teil l, § 2 a.